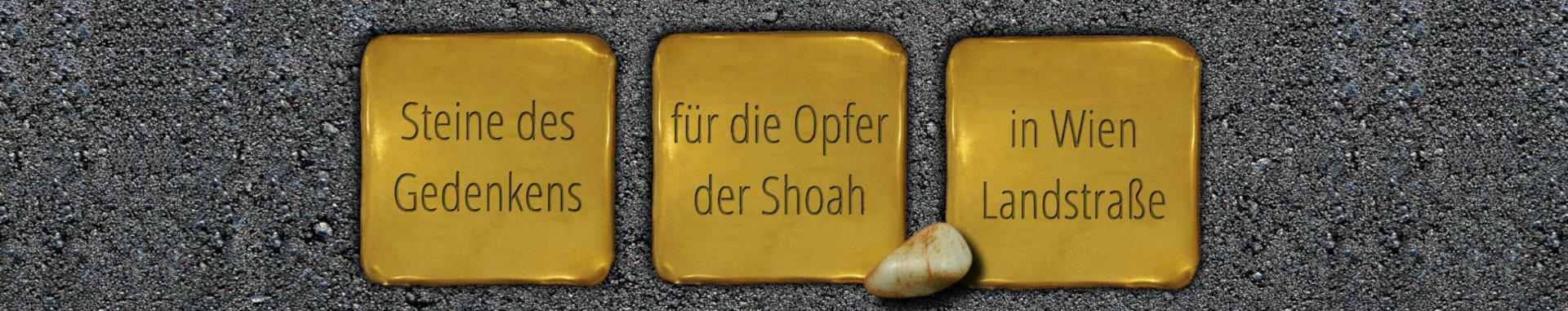Am 31. Dezember 1945, nach Vertreibung und Shoa, lebten laut einer Statistik der Israelitischen Kultusgemeinde-Wien (IKG-Wien) nur 3.955 Juden in Österrreich. Davon hatten 1.096 die NS-Zeit hier als Bedienstete des Ältestenrates, in geschützten Ehen mit einem nichtjüdischen Partner und als so genannte „U-Boote“ überdauern können. Bis Ende 1945 kehrten weiters 822 Menschen aus den Konzentrationslagern und 138 aus dem Ausland zurück. Ein Jahr später zählte die IKG-Wien infolge der anhaltenden Rückkehr der 1938 und danach Vertriebenen 6.428, Ende 1947 8.769 Mitglieder, am 1. Juni 1951 lebten 9.049 und am 1. Jänner 1952 10.074 Juden und Jüdinnen als Mitglieder der IKG in Österreich. Rund 65.000 österreichische Juden und Jüdinnen wurden während des Nationalsozialismus ermordet, rund 120.000 waren aus Österreich geflüchtet oder vertrieben worden.
Als NS-Opfer schienen die Juden im öffentlichen Bewußtsein überwiegend als Mordopfer einiger weniger Kriegsverbrecher auf. Die vom NS-Regime betriebene Ausgrenzung der Juden aus der Gesellschaft als „Fremde“, „Andere“, die mit der übrigen Bevölkerung nichts gemein hätten, zeigte verstärkt durch den fortlebenden Antisemitismus, auch nach Kriegsende ihre Wirkung.
(Österr. Historikerkommission Bd.14: „Arisierung“ und Rückstellung von Wohnungen in Wien. R. Oldenburg Vlg. Wien 2004. ISBN 3-7029-0519-7. Seite 153 dort ausführl. Quellenangaben. / Wr. Städt. Büchereien Katalog-Nr. 692768)
Konzentrationslager Auschwitz:
Auschwitz – der Name gilt heute als Synonym für die Konzentrationslager des Dritten Reiches und die Verbrechen des Holocaust.
Auschwitz-Birkenau lag als das größte nationalsozialistische Konzentrationslager ungefähr 60 Kilometer westlich von Krakau in Polen. Das Lager wurde 1940 auf Befehl von Heinrich Himmler vor den Toren der Stadt Oswiecim errichtet und diente sowohl als Arbeitslager als auch ab 1941 als Vernichtungslager.
Der Komplex setzte sich aus drei Einzellagern zusammen: das Stammlager (Auschwitz I, errichtet zwischen Mai und Juli 1940), Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II, errichtet 1941/42 und Auschwitz-Monowitz (Auschwitz III, 1941 als Zwangsarbeitslager errichtet). Weiterhin gab es noch 39 Außen- und Nebenlager. Häftlinge wurden in Auschwitz II „selektiert“. Wer als nicht arbeitsfähig erachtet wurde – Männer, Frauen und Kinder -, wurde meist sofort in einer der vier als Duschräume getarnten Gaskammern Birkenaus vergast. Eine weitere Gaskammer befand sich in Auschwitz I. In diesen Tötungseinrichtungen konnten täglich mehrere tausend Menschen ermordet werden. Die arbeitsfähigen Gefangenen mussten für verschiedene deutsche Firmen, darunter die IG Farben, arbeiten. Es gab kaum sanitäre Einrichtungen, kaum medizinische Versorgung. Hunger und Seuchen waren an der Tagesordnung.
Im November 1944 wurden angesichts der vorrückenden sowjetischen Armee auf Befehl Heinrich Himmlers die Tötungen durch Gas eingestellt und Gaskammern sowie Krematorien gesprengt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in Auschwitz bereits Millionen Menschen – Juden, Jüdinnen, Roma, Sinti, homosexuelle Frauen und Männer, politisch Verfolgte, Behinderte, Asoziale, Bibelforscher, Menschen aus dem religiösen oder politischen Widerstand – ermordet worden.
Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen das Lager.
1947 wurde durch ein Gesetz des polnischen Parlaments auf den zwei erhalten gebliebenen Teilen des Lagers das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau errichtet. Das Konzentrationslager Auschwitz ist heute Gedenkstätte und der Name Auschwitz wurde zum international verständlichen Symbol für den Völkermord und den Rassenwahn der Nazis.
Der Begriff Auschwitz erlangte jedoch auch im Zusammenhang mit der Leugnung des Holocaust im Begriff „Auschwitz-Lüge“ traurige Berühmtheit. Bis heute bestreiten Rechtsextreme die schrecklichen Vorfälle in dem Lager und die Vernichtung der Juden überhaupt.
Quellen: www.shoa.de, www.auschwitz.org.pl